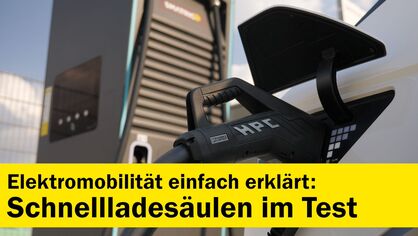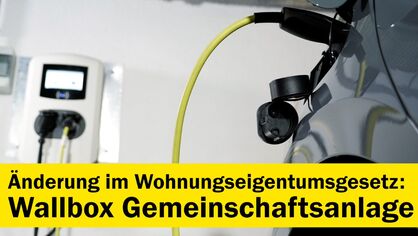Elektromobilität
Alles rund um die E-Mobilität, vom Elektroauto bis zum E-Bike, Hinweise zu Ladestationen, zum Ladeinfrastrukturmarkt sowie zu Förderungen und vieles mehr.
© ÖAMTCElektromobilität ist weiter auf dem Vormarsch
Tests, Untersuchungen, Wallboxen, Förderungen, Neuigkeiten und Innovationen zur E-Mobilität in Österreich sowie Dienstleistungen des ÖAMTC zu diesem Thema.
Welche Elektroautos gibt es in Österreich zu kaufen, was sollte man vor dem Kauf eines E-Autos (Neu oder Gebraucht) beachten, wo findet man die nächste Ladestation, was sollte man vor dem Kauf und der Installation einer Heimladestation wissen.
Fragen und Antworten zur Elektromobilität
Neues aus dem Bereich Elektromobilität
Rund um die Elektromobilität
ÖAMTC TV
Ankaufsförderungen und Steuerbefreiungen
Alles rund um Energie und Laden
ÖAMTC Shop
Alles rund ums Laden Zuhause. Vom Typ2-Ladekabel bis zur intelligenten Wallbox mit integriertem Ladekabel.
Dienstleistungen und Innovationen für E-Autos
ÖAMTC ePower
Einfach, günstig und transparent laden. Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf: Der Mobilitätsclub errichtet österreichweit ein öffentlich zugängliches Ladenetz an ausgewählten ÖAMTC-Standorten.
ÖAMTC Ladekompass
Sie besitzen ein E-Auto und möchten wissen, welcher Tarif für Sie geeignet ist bzw. mit welchen Tarifkosten Sie bei welchem Ladestationsbetreiber rechnen müssen? Mit dem ÖAMTC Ladekompass erhalten Sie einen raschen und transparenten Überblick über die Preise jedes Ladetarifs bei den unterschiedlichen Stationsbetreibern in Österreich.
E-Autos in Österreich
Alle Elektrofahrzeuge, die zur Zeit in Österreich auf dem Markt sind, werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Zu beachten ist, dass nicht mehr alle Fahrzeugmodelle als Neufahrzeuge erhältlich sind, einige Modelle sind nur mehr auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden.
El-Prix-Reichweitentests mit E-Fahrzeugen in Norwegen
Elektroauto kaufen - Neu oder gebraucht?
Der ÖAMTC gibt Ihnen nachfolgend wichtige Tipps, was Sie vor dem Kauf eines Elektrofahrzeuges wissen sollten und was es bei Fahrzeugen mit Antriebsbatterien im Speziellen zu beachten gibt.
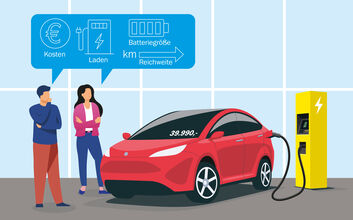
E-Auto Kaufberater - Die …

E-Auto gebraucht kaufen
Wie verhält sich ein Elektroauto im Winter
Tipps für Reisen mit dem E-Auto
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Eine Finanzierung mit Restwert-Garantie
ÖAMTC-Leasing* mit einer Restwert-Garantie! Speziell für Fahrzeuge – wo der Restwert schwer kalkulierbar ist – z.B. Elektrofahrzeuge.
Nähere Infos finden Sie hier: ÖAMTC Kfz Leasing
*Leasing-Vermittler: ÖAMTC Betriebe Ges.m.b.H., GISA-Zahl: 23409217
Leasing-Unternehmen: Raiffeisen-Leasing GmbH

ÖAMTC Kfz-Leasing
E-Bikes & Pedelecs