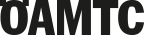Förderungen von E-Fahrzeugen für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine in Österreich
Förderung vom Bund für einspurige Elektrokraftfahrzeuge und E-Ladeinfrastruktur.
Der Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung unterstützt im Rahmen der 2025 gestarteten Aktion „eMove Austria“ des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) mit dem gegenständlichen Programm „E-Mobilitätsoffensive“ in der Säule „eRide“ den Ankauf von klimaschonenden und umweltfreundlichen E-Zweirädern bzw. die Errichtung von Ladeinfrastruktur. Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) setzt den Fördertopf für E-Zweiräder für Private und Betriebe bei 1,5 Millionen Euro an. Die Förderung setzt sich aus dem E-Mobilitätsbonusanteil des Bundesministeriums (BMIMI) sowie dem Anteil der Zweiradimporteure zusammen.
Für die Förderung (eRide) betreffend E-Ladeinfrastruktur für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine stehen Förderungsmittel von 12 Millionen Euro als Pauschalförderung zur Verfügung.
Für die Förderung (eRide) betreffend E-Ladeinfrastruktur auf Basis der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung für betriebliche Projekte (gemäß AGVO) stehen Förderungsmittel von 9 Millionen Euro zur Verfügung.
Die Förderung 2025 läuft solange Förderbudget vorhanden ist, längstens jedoch bis 31.03.2026.
E-Mobilitätsoffensive 2025
Seitens des Bundes werden in Österreich einspurige Elektrokraftfahrzeuge - der Typen L1e und L3e - mit reinem Elektroantrieb (BEV) sowie Elektro-Ladeinfrastruktur gefördert. Beide Fahrzeugtypen sind im Straßenverkehr unterwegs und dürfen nicht auf Radwegen fahren. Pro Antragsteller können jedoch mehrere Anträge für unterschiedliche Fahrzeuge bzw. Ladeinfrastrukturen gestellt werden. Als Einzelmaßnahmen können E-Zweiräder (bis zu 10 Stück pro Antrag) und E-Ladeinfrastruktur gefördert werden. Der Antrag dafür muss nach der Umsetzung der Maßnahme gestellt werden. Die Förderung wird als De-Minimis-Beihilfe ausbezahlt. „DE-MINIMIS“-Förderungen unterliegen einer vereinfachten Förderungsberechnung. Ein Betrieb (+ etwaige vorhandene verbundene Unternehmen) kann „De-minimis“-Förderungen im Gesamtausmaß von 300.000 Euro innerhalb von drei Jahren (fortlaufend, jeweils ab Gewährung einer De-Minimis-Förderung) erhalten. Die Höhe der bisher erhaltenen „De-minimis“ Förderungen wird im Online-Antrag abgefragt. Ladeinfrastruktur auf Basis der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung kann ebenfalls gefördert werden. Diese Anträge müssen vor Umsetzung der Maßnahme (vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung) gestellt werden.
Weitere Infos zur Förderung für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine finden Sie hier.
Höhe der Förderung
Die Fördersätze für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine sind Pauschalfördersätze und in Abhängigkeit des Fahrzeugtyps auf maximal 30 % der umweltrelevanten Investitionskosten begrenzt (Nettokosten des Fahrzeuges bzw. Ladeinfrastruktur lt. Rechnung; jedoch ohne Sonderausstattung bei Fahrzeugen; bei mehreren Ladepunkten muss die beantragte Ladeleistung pro Ladepunkt gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden).
Bei geringen Investitionskosten kommt es daher zu einer Reduzierung der in den nachfolgenden Tabellen angeführten Pauschalbeträgen.
E-Fahrzeuge - Fördersätze für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine
| Förderfähige Fahrzeuge | Förderanteil der Zweiradimporteure (jeweils netto) * | Förderanteil der Bundesförderung | Gesamte Förderhöhe |
|
E-Moped (Klasse L1e) |
350 € | 600 € | 950 € |
|
E-Leichtmotorrad (Klasse L3e ≤ 11 kW) |
500 € | 1.200 € | 1.700 € |
|
E-Motorrad (Klasse L3e > 11 kW) |
500 € | 1.800 € | 2.300 € |
* Der Anteil der Zweiradimporteure bzw. des Sportfachhandels wird vom Netto-Listenpreis ergänzend zu den in der Praxis üblichen gewährten Rabatten in Abzug gebracht.
** Zu beachten: Jedes Rechnungsdatum der übermittelten Rechnungen darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr als 9 Monate zurückliegen.
E-Ladeinfrastruktur - Förderungen für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine
Neben der Förderung von E-Zweirädern wird mit der E-Mobilitätsoffensive 2025 auch wieder betriebliche bzw. öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur seitens des Bundes unterstützt (abhängig ob es sich um einen AC- oder DC-Ladepunkt handelt und ob die E-Ladeinfrastruktur öffentlich zugänglich ist oder nicht). Im Zuge von Erweiterungen der Ladeinfrastruktur (Errichtung zusätzlicher Ladepunkte) wird auch die Umrüstung von bestehenden Ladepunkten auf den aktuellen Stand der Technik gefördert (Erweiterung der Ladeleistung, Modernisierung der Bezahl- und Abrechnungsmodalitäten, Einrichtung neuer Kommunikationsstandards wie ISO 15118). Steht die E-Ladeinfrastruktur auch anderen Nutzern als der/dem Errichter/in offen, so muss den Nutzern einen diskriminierungsfreien Zugang ermöglicht werden, auch in Bezug auf Tarife, Authentifizierungs- und Zahlungsmethoden und sonstige Nutzungsbedingungen. Die Gebühren, die anderen Nutzern für die Nutzung der E-Ladeinfrastruktur in Rechnung gestellt werden, müssen den Marktpreisen entsprechen.
Die Berechnung der Förderung erfolgt in Form einer Pauschale in Abhängigkeit der pro Ladepunkt zur Verfügung gestellten Ladeleistung und beträgt maximal 30 % der umweltrelevanten Investitionskosten (Nettobetrag). Für Großunternehmen ist die Förderung mit maximal 20 % der umweltrelevanten Investitionskosten begrenzt. Bei mehreren Ladepunkten muss die beantragte Ladeleistung pro Ladepunkt gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden.
Umweltrelevante Investitionskosten sind in diesem Zusammenhang:
- Kommunikationsfähige Ladestation/Wallbox (OCPP, Modbus TCP)
- Kommunikationsfähige Ladestationen (OCPP, Modbus TCP) mit integriertem Pufferspeicher zur Erhöhung der gleichzeitig zur Verfügung stehenden Ladeleistung. Die Ladeleistung je Ladepunkt wird exklusive Batterieleistung ermittelt.
- Installationskosten (Material und Montagekosten für bspw. Elektriker und Grabungsarbeiten), die die Ladestelle unmittelbar betreffen, nur in Kombination mit einer förderbaren Ladestation.
- Neuerrichtung der baulichen und elektrischen Basisinfrastruktur (bis max. 50 % der umweltrelevanten Investitionskosten)
- Planungskosten (bis max. 10 % der umweltrelevanten Investitionskosten)
- Lastmanagementcontroller
- Zertifizierungskosten für Barrierefreiheits-Zertifikat
- Stelle zur Preisauszeichnung
| Zugänglichkeit zur Ladeinfrastruktur | Art des Ladepunktes | Leistung | Gesamte Förderhöhe |
|---|---|---|---|
|
Öffentlich zugänglich mit nicht-diskriminierendem Zugang |
AC-Normalladepunkt |
11 bis ≤ 22 kW |
900 € |
|
Öffentlich zugänglich mit nicht-diskriminierendem Zugang |
DC-Schnellladepunkt | < 100 kW |
7.000 € |
|
Öffentlich zugänglich mit nicht-diskriminierendem Zugang |
DC-Schnellladepunkt | ≥ 100 kW bis < 300 kW |
13.000 € |
|
Öffentlich zugänglich mit nicht-diskriminierendem Zugang |
DC-Schnellladepunkt | ≥ 300 kW |
22.500 € |
|
nicht öffentlich zugänglich |
AC-Normalladepunkt |
≤ 22 kW |
400 € |
|
nicht öffentlich zugänglich |
DC-Schnellladepunkt | < 50 kW | 2.500 € |
|
nicht öffentlich zugänglich |
DC-Schnellladepunkt | ≥ 50 bis < 100 kW | 6.000 € |
|
nicht öffentlich zugänglich |
DC-Schnellladepunkt | ≥ 100 kW | 12.000 € |
Einreichverfahren
Das Einreichverfahren für die Förderaktion verläuft in einem 2-stufigen Verfahren über die Förderstelle KPC - Kommunalkredit Public Consulting hier.
Registrierung & Antragstellung
Schritt 1 – Registrierung
Vor der Registrierung prüfen Sie jedenfalls das noch vorhandene Förderbudget auf der Seite der Förderstelle KPC hier.
Für die Registrierung benötigen Sie Ihre Firmenbuchnummer oder den Firmennamen laut Unternehmensregister. Für Vereine: die ZVR-Zahl. Nach der Registrierung ist das Förderbudget für Sie und Ihr E-Zweirad bzw. Ihre Ladeinfrastruktur reserviert. Anschließend haben Sie 36 Wochen Zeit, das E-Zweirad bzw. die E-Ladeinfrastruktur zu übernehmen, zu bezahlen und im Falle des E-Zweirades zuzulassen. Die Rechnung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 9 Monate sein.
Nach der Registrierung erhalten Sie ein Mail mit Ihren Zugangsdaten und eine Auflistung der für die Antragstellung benötigten Unterlagen. Nach Abschluss der Registrierung kann die antragstellende Person und der Projektstandort nicht mehr geändert werden.
Beachten Sie: die Registrierung ist 36 Wochen gültig und wird anschließend automatisch gelöscht. Eine Verlängerung ist unter keinen Umständen möglich.
Schritt 2 – Antragstellung
Der Förderantrag wird nun über die Online-Plattform der Förderstelle gestellt. Dort müssen Sie die Rechnung(en) sowie sonstige Unterlagen (u.a. den Nachweis zum Bezug von Strom aus 100% erneuerbaren Energieträgern) einreichen. Folgen Sie hierzu den Anweisungen im Registrierungs-Mail, welches Sie nach der Registrierung erhalten haben.
Kontrollieren Sie zum Schluss noch einmal Ihren IBAN. Nachträgliche Änderungen können nur schriftlich entgegengenommen werden und bedeuten zusätzlichen Aufwand und daher längere Wartezeit. Nach der erfolgreichen Antragstellung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Anschließend werden Ihre Antragsunterlagen geprüft und wenn alles in Ordnung ist, wird Ihnen die Förderung durch den Klima- und Energiefonds genehmigt und ausbezahlt. Ausschlaggebend für die Gültigkeit der Förderungsbedingungen ist der Zeitpunkt der Registrierung.
Kontrollieren Sie regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach (auch den Spam-Ordner). Die Abwicklungsstelle Kommunalkredit Public Consulting GmbH kommuniziert via E-Mail. Die Nicht-Beachtung kann die Ablehnung Ihres Antrags zur Folge haben (etwa, weil erforderliche Unterlagen nicht fristgerecht nachgereicht werden).
Beachten Sie:
Bei Einzelmaßnahmen für E-Zweiräder (bis zu 10 Stück pro Antrag) und E-Ladeinfrastruktur muss der Antrag nach der Umsetzung der Maßnahme gestellt werden.
Bei Ladeinfrastruktur auf Basis der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung muss der Antrag vor Umsetzung der Maßnahme (vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung) gestellt werden.
Voraussetzungen zum Erhalt der Förderung für Einzelmaßnahmen:
Die Antragstellung erfolgt nach der Umsetzung.
Die Förderung von geleasten Fahrzeugen bzw. von geleaster Ladeinfrastruktur ist zulässig. In diesem Fall ist eine Depotzahlung bzw. eine Vorauszahlung vor der Antragstellung erforderlich. Die Höhe dieser Zahlung muss mindestens der Höhe der erwarteten Bundesförderung zuzüglich 20 % Umsatzsteuer entsprechen.
Die Behaltefrist für geförderte Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur beträgt unabhängig von der Dauer des Leasingvertrages 4 Jahre.
Hinweis: Jede Änderung das geförderte Fahrzeug / die geförderte Ladeinfrastruktur vor dem Ablauf der 4 Jahre betreffend, ist der Abwicklungsstelle per E-Mail - e-mobilitaet@kommunalkredit.at - unter Angabe der Antragsnummer mitzuteilen. Über eine (aliquote) Rückzahlung der Förderung entscheidet der Fördergeber im Einzelfall.
Die E-Fahrzeuge müssen mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern betrieben werden. Der Nachweis des Bezuges von Strom aus 100 % erneuerbaren Energieträgern können Sie folgendermaßen übermitteln: entweder über das Formular: „Bestätigung des Strombezugs aus erneuerbaren Energieträgern“ von Ihrem Energieanbieter ODER mit Ihrer letzten Stromrechnung, die eine Stromkennzeichnung ausweist ODER Ihre letzte Abrechnung von Ladevorgängen an Ladesäulen, die mit 100% Strom aus erneuerbaren Energieträgern versorgt werden ODER die Rechnung Ihrer PV-Anlage."
Zum Erhalt des Förderanteils des Bundes muss bei der Antragstellung der E-Mobilitätsbonus des Fahrzeughandels beim Kauf des Fahrzeuges bereits in korrekter Höhe in Abzug gebracht worden sein und auf der Fahrzeugrechnung bzw. im Leasingvertrag als „E-Mobilitätsbonus“ bezeichnet und mit dem nachstehenden Informationstext ausgewiesen sein:
„Die E-Mobilitätsoffensive ist ein wichtiger Beitrag der österreichischen Bundesregierung für klimafreundliche Mobilität in Österreich. Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) gewährt gemeinsam mit den Zweiradimporteuren einen E-Mobilitätsbonus für E- Mopeds und E-Motorräder. Der E-Mobilitätsbonusanteil, der Zweiradimporteure wird, unabhängig von etwaigen zusätzlichen Nachlässen von Importeuren bzw. Handel, für den Ankauf von E-Zweirädern bewilligt und ist auf der Rechnung extra auszuweisen. Der E-Mobilitätsbonusanteil des BMIMI für den Ankauf von E- Mopeds und E-Motorrädern kann – sofern alle Voraussetzungen im Sinne der Förderaktion erfüllt sind – nach zuerst erfolgter Registrierung und anschließender Fördereinreichung bei der Abwicklungsstelle KPC (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) unter www.umweltfoerderung.at zur Auszahlung gelangen. Der zum Betrieb erforderliche Strom muss nachweislich mit erneuerbaren Energieträgern produziert werden. Die gegenständliche Förderaktion des Klima- und Energiefonds und des BMIMI erfolgt im Rahmen von eMove Austria und des klimaaktiv mobil-Programms.“
Hinweis: Nur wenn der entsprechende E-Mobilitätsbonus seitens des Fahrzeughandels gemäß obenstehendem Informationstextes auf der Rechnung bzw. im Leasingvertrag angeführt ist, kann auch der Bundesanteil zur Auszahlung gelangen. Förderanträge mit Rechnungen bzw. Leasingverträgen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, werden abgelehnt.
Das E-Zweirad muss neu sein bzw. kann es auch ausschließlich beim Händler in Betrieb gewesen sein. Hier darf aber keine Förderung im Rahmen des Aktionspakets E-Mobilität des Bundes durch den Händler bezogen worden sein. Für Fahrzeuge dieser Art darf der Zeitraum zwischen Erstzulassung (beim Händler) und dem aktuellen Zulassungsdatum bei der Fördereinreichung nicht mehr als 15 Monate betragen.
Das Rechnungsdatum darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr als 9 Monate zurückliegen.
Zusätzliche Voraussetzungen für den Erhalt der Förderung für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur:
Die Ladeinfrastruktur muss in das Ladestellenverzeichnis der E-Control eingetragen werden (hierfür sind Echtzeitdaten bereitzustellen).
- Einhaltung der Vorgaben der RVS 03.07.21 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Raum, auch wenn diese nicht im öffentlichen Raum errichtet werden. Dies betrifft insbesondere Anforderungen zu Geometrie und Bedienungselementen. Da die RVS derzeit nur Regelungen für PKW-Ladeinfrastruktur enthält, sind diese Vorgaben ausschließlich für entsprechende Infrastruktur verbindlich. Bei größeren Ladeparks gilt folgende Mindestausstattung gemäß RVS:
- bis zu 2 Ladeplätze: 100 %
- bis zu 4 Ladeplätze: min. 50 %
- ab 5 Ladeplätze: min. 25 %
- Öffentliche Zugänglichkeit u. Nutzbarkeit der geförderten Ladeinfrastruktur an 7 Tagen der Woche 24 Stunden.
- Nichtdiskriminierende Zahlungs- und Roamingfähigkeit, sowie eine faire und nichtdiskriminierende Gestaltung der Roaming-Gebühren sind sicherzustellen. Dies kann durch das Einstellen eines Offer To All (OTA) auf einer Roaming-Plattform erfolgen, um die Voraussetzung zu schaffen, dass mit jedem interessierten Roaming Partner in einem angemessenen Zeitraum und zu fairen Konditionen ein Roaming-Vertrag abgeschlossen werden kann.
- Die Ladeinfrastruktur ist so zu errichten, dass sie den Vorgaben der Verordnung (EU) 2023/1804 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR), welche seit dem 13. April 2024 gilt, gerecht wird. Folgende Vorgaben werden exemplarisch genannt:
- Der berechnete Ad-hoc-Preis muss auf dem Preis pro kWh für den gelieferten Strom beruhen (Blockiergebühren möglich) und transparent ausgewiesen werden (Artikel 5 Absatz 4).
- Ladepunkte müssen digital vernetzt und zu intelligentem Laden fähig sein (Artikel 5 Absatz 7f).
- An den geförderten Ladestationen über 50 kW Ladeleistung ist die Bezahlung über gängige Zahlungsinstrumente wie Debitkarten oder Kreditkarten (Terminal) bzw. über kontaktloses Zahlen ohne vorherige Registrierung über NFC (Near Field Communication) sicherzustellen (Artikel 5 Absatz 1).
Zusätzlich wird bei der Errichtung folgendes empfohlen:
- Errichtung des Ladeplatzes auf bereits versiegelten Flächen bzw. Errichtung des Ladeplatzes auf versickerungsfähigen/teilversiegelten Flächen unter Berücksichtigung der Vorgaben hinsichtlich Barrierefreiheit;
- integrierter-/MID-konformer Stromzähler;
- Hardware mit ISO 15118 Kommunikationsfähigkeit. Bitte beachten Sie, dass gemäß DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2025/656 DER KOMMISSION vom 2. April 2025 zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/1804 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Normen für das kabellose Aufladen, das elektrische Straßensystem, die Vehicle-to-Grid-Kommunikation und die Wasserstoffversorgung für Straßenfahrzeuge ab dem 8. Januar 2026 neu errichtete oder instand gesetzte öffentlich zugängliche Wechselstrom- und Gleichstrom-Ladepunkte für leichte und schwere Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb folgenden Normen entsprechen müssen:EN ISO 15118-1:2019;
- EN ISO 15118-1:2019;
- EN ISO 15118-2:2016;
- EN ISO 15118-3:2016;
- EN ISO 15118-4:2019;
- EN ISO 15118-5:2019.
Für nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur gelten folgende Bedingungen:
- Die betriebliche Ladeinfrastruktur ist unabhängig vom Fahrzeugkauf förderfähig, muss aber von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb installiert und bei ≥ 3,6 kVA beim Netzbetreiber gemeldet werden.
Was wird nicht gefördert (Einzelmaßnahme Antrag nach der Umsetzung)?
- Elektrofahrräder („E-Bikes“)
- Gebrauchtfahrzeuge und gebrauchte Ladeinfrastruktur
- Neufahrzeuge mit einer Rechnung älter als 9 Monate
- Mobile Ladestationen
- Intelligente Ladekabel
- Gemietete Ladestationen
- Ladestationen, für die ein gesetzlicher oder behördlicher Auftrag zur Errichtung besteht
- Kostenlos zur Verfügung gestellte Ladeinfrastruktur
- Eigenleistungen (auch für verbundene Unternehmen)
- Netzerrichtungskosten (Netzzutritts- und -zugangsgebühren, Trafo, …)
- Parkplätze, Gehwege, Fahrbahnen
- Überdachungen
- Beleuchtung
- Finanzierungskosten
- Kosten für stromproduzierende Anlagen und externe Speicher
- Softwarelizenzkosten
- Garantien
- Steckdosen aller Art
- (Hinweis)Schilder
- Reparatur- und Instandhaltungskosten
- Allfällige Abgaben und Gebühren
- Grundstücks- und Aufschließungskosten
- Folierungen für die Ladestation
- Asphaltierungen und Bodenmarkierungsarbeiten
- Pauschalbeträge auf Rechnungen
- Förderberatung, Förderungseinreichung
- Entsorgungskosten
Voraussetzungen zum Erhalt der Förderung für Maßnahmen:
Die Antragstellung erfolgt vor der Umsetzung.
Die Förderung wird in Form eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Investitionszuschusses vergeben und erfolgt im Rahmen des Klima- und Energiefonds.
- Für den Standort der Ladestellen bzw. jenem Standort, an dem Fahrzeuge hauptsächlich geladen werden, ist der Nachweis über den Bezug von Strom aus ausschließlich erneuerbaren Energieträgern auf eine der folgenden Arten zu erbringen:
Wird der Strom aus erneuerbaren Energieträgern zugekauft:
- Stromliefervertrag mit einem der Energieversorger, die taxativ im jeweils aktuellen Stromkennzeichnungsbericht der e-control (Tabelle „Stromkennzeichnungen der evaluierten Lieferanten im Vergleich“) als „Grünstromanbieter“ angeführt werden, oder
- Formular Bezug erneuerbarer Energieträger mit Bestätigung durch das Energieversorgungsunternehmen, oder
- Vertrag über die Ladeberechtigung, sofern Ladungen hauptsächlich an öffentlich zugänglichen Ladestellen erfolgen.
- Wird der Strom hauptsächlich aus einer eigenen stromproduzierenden Anlage (PV-Anlage, Windkraftanlage) bezogen, ist ein geeigneter Nachweis (Rechnung der Anlage) vorzulegen. Mit dieser Anlage muss der Jahresbedarf der Ladestellen abgedeckt werden können.
- Die KPC empfiehlt Strom aus zertifizierten Anlagen (die zertifizierten Lieferanten finden Sie unter diesem Link).
Es muss ein Mobilitäts- und/oder Verkehrskonzept mit Berechnung des Umwelteffekts vorliegen, in dem sich die zur Förderung beantragten Maßnahmen wiederfinden. Bei Fragen zur Erstellung des Mobilitätsund Verkehrskonzepts wenden Sie sich bitte an die vom BMIMI beauftragten klimaaktiv mobil- Beratungsprogramme für Betriebe, Gemeinden, Freizeit und Tourismus. Es entstehen Ihnen dadurch keine zusätzlichen Kosten:
- Die Projekte werden anhand des Einlangens der vollständigen Unterlagen gereiht und gelangen gemäß dieser Reihung zur Förderung, solange Budget verfügbar ist.
- Es wird nur jener Umwelteffekt berücksichtigt, der durch Umsetzung der Maßnahme in Österreich erzielt wird.
- Gebietskörperschaften müssen den Nachweis erbringen, dass 15 % der Investitionskosten für die förderungsfähige Maßnahme selbst getragen werden. Geförderte Ladeinfrastruktureinrichtungen müssen 4 Jahre in Betrieb gehalten werden.
- Für alle genannten Förderungsangebote gilt: Einreichen können alle Betriebe, sonstige unternehmerisch tätige Organisationen sowie Vereine, konfessionelle Einrichtungen und öffentliche Gebietskörperschaften. Die Förderung ist mit 3 Mio. Euro je Unternehmen (inkl. verbundene Unternehmen) für die gesamte Förderperiode begrenzt.
Weitere Förderungsbestimmungen
- Bei Finanzierung der geförderten Maßnahme über Leasing, Mietkauf oder einem ähnlichen Finanzierungsmodell kann als Förderungsnehmer:in nur der:die Eigentümer:in der geförderten Anlage auftreten. Die Anlage muss gemäß Leasing- oder Mietvertrag spätestens mit der letzten Rate in das Eigentum der antragstellenden Person übergehen. Die Förderung kann maximal im Ausmaß der von dem:der Förderungsnehmer:in bis zum Zeitpunkt der Endabrechnung tatsächlich getätigten Zahlungen ausbezahlt werden. Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrages der Förderung werden etwaige Depotzahlungen sowie die getätigten Netto-Ratenzahlungen herangezogen.
- Die Einhaltung der Publizitätsbestimmungen ist zu gewährleisten. Weiterführende Informationen dazu finden Sie im Infoblatt „Endabrechnung“
Unterliegt der/die Antragsteller:in den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes, so sind diese einzuhalten.
- Rechtliche Grundlage für die Vergabe dieser Förderung bilden die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) ABl. Nr. L 187 vom 26.06.2014 S. 1 zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2023/ 1315 ABl. Nr. L 167 vom 30.06.2023 S. 1 insbesondere Art 36a, 36b dieser Verordnung bzw. die Verordnung (EU) Nr. 2022/2472 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Agrarische Freistellungsverordnung) ABl. Nr. L 327 vom 21.12.2022 S. 1 insbesondere Art 14 dieser Verordnung sowie in Umsetzung dieser Verordnungen die jeweiligen Bestimmungen der klimaaktiv mobil-Förderungsrichtlinie 2013 idgF. Die Erforderlichkeit der Förderung wird in der unabhängigen Markstudie zur Erforderlichkeit von Beihilfen für Investitionen in Lade- oder Tankinfrastruktur, lt. AGVO 36a, § 10 und 11 dargelegt.
- Projektänderungen gegenüber den Angaben bei Antragstellung sind umgehend, schriftlich und vor Genehmigung bzw. Beauftragung bekannt zu geben.
Was wird nicht gefördert (Antrag vor der Umsetzung)?
- Mobile Wallboxen
- Gemietete Wallboxen
- Intelligente Ladekabel
- Kostenlos zur Verfügung gestellte Ladeinfrastruktur
- Eigenleistungen
- Netzzutritts- und -zugangsgebühren
- Kosten für Trafos
- Finanzierungskosten
- Kosten für stromproduzierende Anlagen
- Neu errichtete Zuleitungen
- Reparatur- und Instandhaltungskosten
- Allfällige Abgaben und Gebühren
- Grundstücks- und Aufschließungskosten
- Ladestationen, für die ein gesetzlicher oder behördlicher Auftrag zur Errichtung besteht
- Ladeinfrastruktur, die im Zuge der Konzessionsvergabe bei Rastplätzen der ASFINAG errichtet wird.
Ebenso nicht gefördert werden Kosten für immaterielle Leistungen, die 10 % der förderungsfähigen (materiellen) Investitionskosten übersteigen.
Quellen: BMIMI, KPC