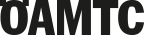Das ÖAMTC Starthilfe 1x1
Fehler mit Starterkabeln können teure Elektronikschäden verursachen; bei schwachen Batterien sind Akkupacks ratsam, auch für E-Autos
Die Kombination aus tiefen Temperaturen und starker Nutzung elektrischer Verbraucher wie Licht, Scheibenwischer und Heizung macht leere Batterien im Winter zur Pannenursache Nummer Eins. "Ist die Batterie zu schwach für den Startvorgang, springt der Motor nicht mehr an. Dann ist eine Starthilfe notwendig", erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Das kann übrigens auch E-Autos betreffen: Sie verfügen über eine 12-Volt-Batterie, die für das Zuschalten des Hochvoltstromnetzes und den Elektromotor notwendig ist. Ist die Startbatterie fast oder ganz leer, brauchen auch E-Autos Starthilfe. Diese funktioniert im Prinzip genauso wie bei Verbrennern – daher kann auch ein Elektroauto als Spenderfahrzeug fungieren und einem anderen Fahrzeug Starthilfe geben. Wichtig ist, dass man hier die Angaben des Herstellers genau beachtet.
Unabhängig von der Antriebsart: Wer auf Nummer sicher gehen will, alarmiert für die Starthilfe einen Pannendienst. Das gilt vor allem dann, wenn nicht bekannt ist, warum die Batterie zu schwach zum Starten ist. "Oft geht die Batterie bei Minusgraden nämlich kaputt und muss getauscht werden", weiß der ÖAMTC-Techniker. Ist die Batterie noch in Ordnung, springt der Motor mit der richtigen Starthilfe wieder an und die Batterie wird bei einer längeren Fahrt wieder geladen. "Die sicherste und bequemste Art der Starthilfe sind tragbare, leistungsfähige Akkupacks. Sie sind perfekt für E-Autos und Hybride und eignen sich genauso für alle anderen Pkw. Außerdem kann man mit diesen Energypacks auch Smartphone und Co. aufladen", erklärt Kerbl.
Achtung: Wer für die Starthilfe Starterkabel verwendet, muss vorsichtig sein: Die falsche Handhabung kann an allen beteiligten Fahrzeugen teure Elektronikschäden verursachen.
ÖAMTC-Tipps für die richtige Starthilfe mit Starterkabeln
- Spannung prüfen: Wichtig ist, dass die Nennspannung beider Autobatterien gleich ist – in der Regel zwölf Volt. Die Fahrzeuge dürfen einander nicht berühren. Der Motor und alle Stromverbraucher des Spender-Kfz, wie Radio und Licht, müssen abgeschaltet sein. "Und die Starthilfekabel sollten einen Überspannungsschutz haben", rät der Techniker des Mobilitätsclubs.
- Richtig verbinden: Beim Zusammenschließen klemmt man zuerst ein Ende des roten Starthilfekabels an den Pluspol (+) der entladenen Batterie. Das andere Ende schließt man dann an den Pluspol der Spenderbatterie an. Danach wird ein Ende des schwarzen Kabels an den Minuspol (-) der Spenderbatterie angebracht. Dieses Kabel wird dann beim Fahrzeug, das Starthilfe benötigt, mit einem unlackierten Metallteil oder dem Motorblock selbst verbunden. "Achtung: Den Minuspol der entladenen Batterie darf man nicht mit dem Kabel berühren. Wenn das passiert, kann sich durch Funkenflug Knallgas entzünden", warnt Kerbl.
- Starthilfe geben: Ist die Verbindung korrekt hergestellt, wird zuerst der Motor des Spenderfahrzeugs, anschließend der des anderen Autos gestartet. "Die Verbindung zwischen den Autos sollte eine halbe Minute lang aufrecht bleiben. Das schont die Elektronik", weiß der ÖAMTC-Experte.
- Ordentlich aufladen: Anschließend kann der Motor des Spenderfahrzeugs abgestellt werden. Läuft der Motor des anderen Autos weiter, werden die Kabel in umgekehrter Reihenfolge entfernt. "War die Batterie nur leer und nicht defekt, lädt sie sich während einer längeren Fahrt wieder auf. Im Winter sollte man dazu mindestens eine Stunde lang außerhalb des Stadtgebiets fahren", rät Kerbl abschließend.